ダウンロード数: 97
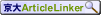
このアイテムのファイル:
| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| dkh00036_001.pdf | 9.84 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
| タイトル: | 亡き父の現前、死を待つ伯父の社交 --シュティフターの『老独身者』あるいは世代形成の文化的実践-- |
| その他のタイトル: | Die Gegenwart der Toten und die Geselligkeit --Stifters Hagestolz und die kulturelle Praktik der Generationsbildung-- |
| 著者: | 杉山, 東洋  |
| 著者名の別形: | SUGIYAMA, Toyo |
| 発行日: | Jan-2023 |
| 出版者: | 京都大学大学院独文研究室研究報告刊行会 |
| 誌名: | 研究報告 |
| 巻: | 36 |
| 開始ページ: | 1 |
| 終了ページ: | 24 |
| 抄録: | Eine der ältesten Rezensionen von Stifters Novelle Der Hagestolz (Journalfassung: 1845; Buchfassung: 1850) vertritt die Ansicht, dass „jeder, der sie liest“ mit dem Inhalt sympathisieren müsse. Die bisherige Forschung hatte jedoch die Tendenz, diese Novelle nur hinsichtlich ihrer Bezüge zur Biographie des Autors zu diskutieren wie beispielsweise seiner kinderlosen Ehe. Um dieses eingeschränkte Blickfeld zu erweitern, befasst sich die vorliegende Abhandlung mit den sozialgeschichtlichen Hintergründen der Erzählung und damit, welche Bedeutung diese für ihre Interpretation haben. Für ein Verständnis des historischen Kontexts der Novelle ist es notwendig, die vielfältigen Veränderungsprozesse nachzuzeichnen, die der Begriff der „Generation“ um 1800 durchlief. Damals begann man, das Wort „Generation“ nicht mehr nur in diachroner, sondern auch in synchroner Bedeutung zu verwenden. Gleichzeitig entwickelte die Naturwissenschaft biologische Generationsmodelle. Im modernen Recht führte das zu einer allgemeinen Anerkennung der Blutsverwandtschaft im Erbrecht bürgerlicher Familien. Daneben verloren die Verstorbenen zunehmend ihren Status als Rechtssubjekt, so dass sie nur noch als Leichen im naturwissenschaftlichen Sinn behandelt wurden. Diese rechtliche Abwertung der Toten ist ein kulturelles Phänomen, das in scharfem Gegensatz zur andauernden Gegenwart der Toten in der mittelalterlichen Kultur und danach steht. Das hatte auch Auswirkungen auf das Testament, dessen Bedeutung ebenfalls durch das biologische wie juristische Verständnis der „Generation“ beeinflusst wurde. Dieses Rechtsinstrument versicherte nun die Grenze zwischen Toten und Lebenden, indem es die Verbindung des diesseitigen Lebens mit dem letzten Willen der schon im Jenseits weilenden Toten neu regelte. Die beschriebene Auffassung von „Generation“ um 1800 ist bei einer Interpretation der Konstruktion von Generationen in Der Hagestolz zu berücksichtigen. Das Motiv des Testaments spielt in Stifters Erzählung eine wichtige Rolle. Die Stiefmutter Ludmilla sorgt für den Protagonisten Viktor, weil dessen toter Vater Hippolith dies so in seinem Testament gewünscht hatte. Die daraus entstehende Beziehung zwischen Mutter und Sohn wird aber von Viktor und Ludmilla selbst keineswegs mit einer blutsverwandtschaftlichen gleichgesetzt. Hier spiegelt sich das moderne Verständnis der „Generation“ wider. Die konkreten Hintergründe der älteren Generation, zu der Ludmilla, Hippolith und der namenlose Oheim Viktors gehören, kommen in der erzählten Vergangenheit des Oheims und der Schilderung seines Lebensraums zum Vorschein. Der alte Junggeselle, ein früherer Zögling der Akademie, lebt jetzt in einem aufgegebenen Kloster. Die Darstellung seines Lebens ist deshalb vielleicht vom Josephinismus beeinflusst, der dem Geistlichen, also z. B. den Lehren des Klosters, ablehnend gegenüberstand. Das vom Oheim gezeichnete Bild des jungen Hippolith in der Vergangenheit ist ein weiteres Indiz hierfür, dient aber zugleich als Anlass für Viktors Partnerwahl in dieser Novelle. Nachdem letzterer das Porträt der jungen Ludmilla sah, deren Gestalt der seiner Stiefschwester Hanna sehr ähnelt, entschließt sich Viktor nach seiner Heimkehr zur Ehe mit Hanna. In dieser Erzählung ist also sowohl das moderne biologische Verständnis von Verwandtschaft bedeutsam als auch die vormoderne oder nicht auf Biologisches beschränkte Beziehung zwischen mehreren Generationen. In diesem Sinn erweist sich der Begriff der „Generation“ in Der Hagestolz als ambivalent. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist auch Stifters Verwendung der Wörter „Band“ und „Kette“ interessant. Gegenüber der traditionellen diachronen „Kette der Geschlechter“ kommt in Der Hagestolz den „Banden“ der Familie eine wichtige synchrone Bedeutung zu. Darüber hinaus werden auch die nicht durch verwandtschaftliche Bande konstituierten „Verhältnisse“ zwischen Viktor und dem Oheim erwähnt. Ihre Beziehung könnte man vor dem historischen Hintergrund des zeitgenössischen Begriffs der „Geselligkeit“ sehen, mit dem sich um 1800 zuerst F. D. E. Schleiermacher theoretisch beschäftigte. Eine Analyse der Motive des Hundes, der Mahlzeit und der tödlichen Atmosphäre in der Erzählung erweist zudem die besondere Funktion einer eigentümlichen Geselligkeit und ihrer Entfaltung zwischen den Figuren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die in Stifters Der Hagestolz dargestellten Beziehungen als kulturelle Praktik ein ambivalentes Verhältnis zu dem Verständnis von „Generation“ um 1800 aufweisen. Allerdings ist dies nicht allein aus der Biographie des Autors herzuleiten. Zwar machte Stifter durchaus persönliche Erfahrungen mit dem Tod von Verwandten, der Kultur der Gegenwart der Toten oder mit Testamenten, doch waren dies auch soziale Tatsachen in der Erfahrungswelt seines Publikums, das daher mit dem Inhalt der Novelle sympathisieren konnte. |
| URI: | http://hdl.handle.net/2433/279476 |
| 出現コレクション: | 36号 |
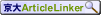
このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。

