このアイテムのアクセス数: 437
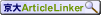
このアイテムのファイル:
| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| dkh00010_021.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
| タイトル: | ローベルト・ヴァルザーにおける寓話性(1) : 散文小品『通り(I)』について |
| その他のタイトル: | Parabolisches bei Robert Walser (1) : Über das Prosastück 》Die Straße (I)《 |
| 著者: | 吉田, 孝夫 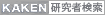 |
| 著者名の別形: | Yoshida, Takao |
| 発行日: | Mar-1997 |
| 出版者: | 京都大学文学部独文研究室 |
| 誌名: | 研究報告 |
| 巻: | 10 |
| 開始ページ: | 21 |
| 終了ページ: | 49 |
| 抄録: | Unter dem Terminus "die moderne Parabel" werden im allgemeinen die änigmatischen relativ kurzen Dichtungen dieses Jahrhunderts behandelt, und Kafka als der "metaphysische" und Brecht als der "pragmatische" Paraboliker sind die wichtigsten Figuren in diesem Problemfeld. Während die traditionelle Parabel, wie z.B. die biblische, irgendeine bestimmte Lehre in sich enthält, versucht die moderne Art der Parabel darauf zu verzichten, weil sie in einem veränderten Zeitalter entstanden ist, wo keine allgemeingültige Ordnung des Denkens mehr selbstverständlich sein kann, die die Existenz einer solchen Lehre rechtfertigen würde. Robert Walser (1878-1956) wurde im oben skizzierten Problemfeld bisher nur eine Nebenrolle zugeteilt. Der vorliegende Versuch will aber die Sonderstellung zeigen, die Walser hier einnehmen könnte. Die Gattung der Parabel kann als ein eigentümliches Spannungsfeld zwischen einer Lehre und einem Bild bezeichnet werden, und Walser vermochte diese Grundstruktur der Parabel für seine dichterische Welt geschickt anzuwenden. In »Die Straße (I)« als der Beobachtung des Alltags bei einem Spaziergang fallen folgende Charakteristika auf. Erstens: das Übergewicht des Präteritums. Formal ist es das bestimmende Tempus der Gattung, die dadurch die Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft des einmaligen, nicht selten sogar überwirklichen und paradoxen Geschehens bekräftigen will. Zweitens: die Zitat aus der Bibel. Das Verfahren, Zitate zu verwenden, ist an sich bei Walser nicht ungewöhnlich, wie z.B. die Verflechtung der Briefe Kleists in seine bekannte Erzählung »Kleist in Thun« belegt. Hinzu kommt, daß vor allem die Bibel ein Urquell der Parabel-Gattung ist. Indem Walser hier eine Phrase aus Joh 8, 14 bearbeitet, kommt, sozusagen unterschwellig, eine parabolische Wesenheit als "das Transfersignal zur Richtungsänderung des Bedeutens" (Zymner) zum Tragen. Außerdem fällt auf, daß bei allen Beschreibungen unbestimmte und relativ schlichte Termini vorherrschend sind, wobei folgerichtig die klaren Züge der Personen anhand dieser Schilderungen schwer vorstellbar sind. Selbst ins Klischeehafte fallen die Beschreibungen. Daraus resultiert, daß sich der vertraute Alltag, den Walser hier angeblich beschreibt, in eine andere, irgendwie abstrakte Welt verwandelt. Der Gang des Betrachters wird auch im Tempus des Textes reflektiert; im Übergewicht des Präteritums funktionieren die 2 Ausnahmen des Plusquamperfekts am Anfang und des Präsens in der Mitte so, daß im Text der Gang der Zeit vage zum Vorschein kommt, und in der Zusammenwirkung mit dem zitathaften Ausdruck aus der Bibel: "Woher kamen und wohin gingen sie" kann eine metaphysisch-existentielle Szenerie auf dieser Alltagsbühne eingerichtet werden. Diesem dynamischen Strom der Zeit steht aber die Statik der auf der Straße sich stauenden Masse in einem sich einander relativierenden Verhältnis entgegen. Sogar die Gerührtheit des spazierend beobachtenden Ästheten wird von den anderen klischeehaften Figuren relativiert. Nirgends findet sich so etwas wie eine Stellungnahme oder Lehre des Autors, und das war wahrscheinlich auch seine Intention: Das Walser'sche Ich ist in anderer Weise als das typisch europäische Ich konzipiert, das von sich fordert, alles und die Welt überhaupt zu sein. Eher zieht Walser das Ich vor, das "die Welt vor solcher Kälte und Willkür des Ich schützen" (Kurzawa) will. In diesem Sinne sollten die einzelnen Dinge im Alltag in einem Gleichgewicht stehen, indem sie nur als ein etwas Andeutendes dasind. Walser hat diese alltägliche Szene als einen nichts-sagenden Text gestaltet, dessen innere Elemente einander relativieren, und konnte so der Tyrannei des Sinn-zwingenden Ichs entkommen eben im Rahmen der Parabel, die trotzdem als eine Art Magnetfeld die Welt in irgendeiner, wie eine Ahnung existierenden Bedeutung behalten sollte. |
| URI: | http://hdl.handle.net/2433/134410 |
| 出現コレクション: | 10号 |
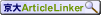
このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。

